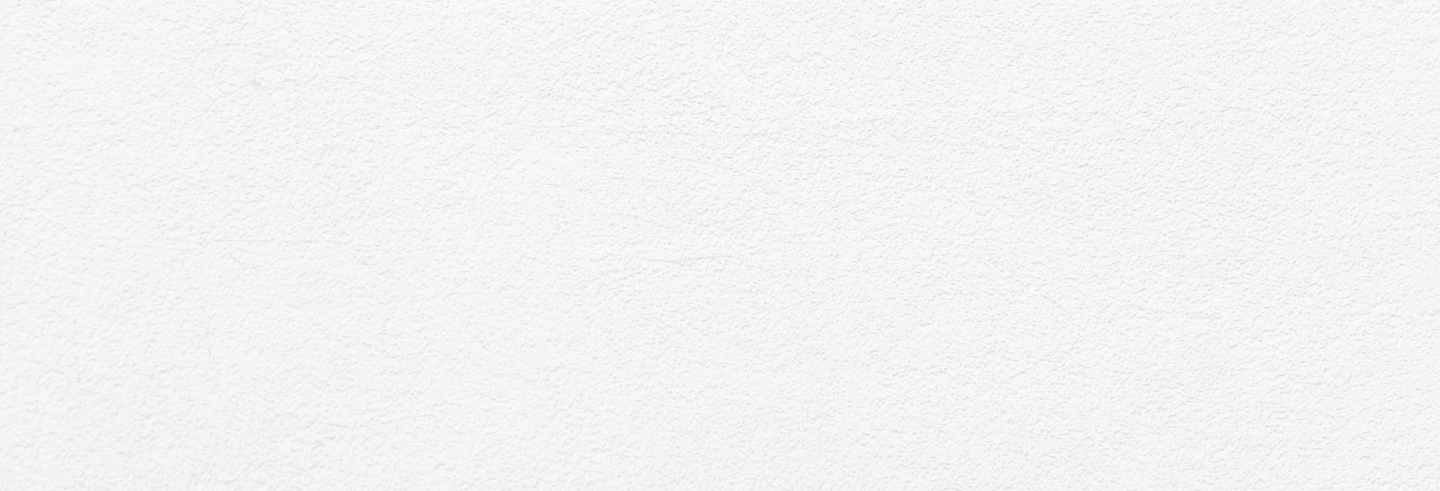Bestechung und Bestechlichkeit
Die Korruptionstatbestände der §§ 299a und 299b StGB stellen viele Fälle unter Strafe, in denen ein Angehöriger eines Heilberufs ökonomische Interessen dem Patienteninteresse vorzieht. Die Korruption im Gesundheitswesen hat jedoch viele Gesichter. Der folgende Beitrag soll einen Überblick über typische Sachverhalte in der Praxis bieten.

Korruption im Gesundheitswesen ist seit vielen Jahren in aller Munde. Sie hat insbesondere mit dem „Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen“ vom 4.6.2016 als Reaktion auf das ablehnende Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Strafbarkeit von Vertragsärzten wegen Korruptionsdelikten vom 29.3.2012 zu zahlreichen Publikationen und Bearbeitungen geführt. Zur Überraschung juristischer Laien bleiben jedoch angestellte oder verbeamtete Ärzte sowie andere abhängig Beschäftigte im Gesundheitswesen nicht außen vor. Vielmehr sind für sie nach wie vor die teilweise sogar strengeren §§ 331 ff. StGB für Amtsträgerkorruption sowie die Tatbestände des § 299 StGB mit den Begehungsmöglichkeiten zum Nachteil des fairen Wettbewerbs oder mittlerweile der Interessen des Geschäftsherren maßgeblich. Als spezielle Ergänzung treten die neuen §§ 299a und 299b StGB als Strafnormen für das Gesundheitswesen hinzu, wobei im Wesentlichen besonders wichtige berufs- und sozialrechtliche Gebote und Wertungen zum Schutz eines fairen Gesundheitswettbewerbs und zumindest mittelbar des Patientenvertrauens in unabhängige Heilberufsausübung aus dem SGB V, der MBO-Ä und der MBO-Z strafrechtlich erfasst werden.
Sehr strenge Kodizes
Erfahrungsgemäß stellen sich gerade den als Nichtjuristen betroffenen Beschäftigten im Gesundheitswesen sehr viel konkretere Fallfragen. Wertvolle Hilfen hierzu liefern Branchen- sowie Verbandskodizes, -leitlinien und -empfehlungen, aus denen sich deutlich kleinteiligere Hinweise und Beispiele entnehmen lassen. Jedoch sind diese Werke regelmäßig deutlich strenger als die (straf-)rechtlichen Anforderungen; es geht nämlich auch darum, den bereits schwer aushaltbaren strafrechtlichen Ermittlungsdruck zu vermeiden. Dieser Beitrag versucht durch eine Zusammenstellung aus Themengruppen, Schulungsfallbeispielen, praktischen Erfahrungen und einer Fallsammlungsauswertung einige Antworten zu geben, zu sensibilisieren und Wissenslücken zu schließen, um die tatbestandlich vorausgesetzte Verknüpfung von Unrechtsvereinbarung als unlautere Bevorzugung im Gesundheitswettbewerb gegen Vorteilszuwendung zu veranschaulichen.
Sozialadäquate Zuwendungen
Für die Praxis ist hierbei die sogenannte Sozialadäquanz als wertvolles Indiz gegen eine Unrechtsvereinbarung sehr wichtig. Sozialadäquate Zuwendungen sind Vorteilsgewährungen so geringen Umfangs im Rahmen allgemeiner Höflichkeitsregeln oder der Verkehrssitte, dass sie zu Wettbewerbsbeeinträchtigungen als ungeeignet gelten.
Top-Korruptionsthemen
Nachfolgend finden sich einige Top-Korruptionsthemengruppen, die sich als Einfallstore vor allem für Korruption im Gesundheitswesen, aber auch im geschäftlichen Verkehr oder bei Korruption von Amtsträgern und damit als Anlässe für strafrechtliche Ermittlungen herausgestellt haben. Es werden den einzelnen Bereichen möglichst praxistypische Fallkonstellationen zugeordnet. Überschneidungen und Grenzfälle sind dabei zwar unvermeidlich, aber unschädlich; Vollständigkeit ist leider nicht möglich.
Auftragsvergaben sowie Beschaffungen von Medizinprodukten
Bei Auftragsvergaben und Beschaffungsentscheidungen kann jedes wirtschaftlich auffällige Ungleichgewicht einer Vereinbarung Vermutungen über verdeckte Begleitinteressen und damit Ermittlungsrisiken auslösen. So sind Vergünstigungen oder Arzneimittel, Hilfsmittel oder Medizinprodukte und sonstige Geräte oder Produkte für den Praxis- oder Krankenhausbedarf als Zugaben gegen Bevorzugungen bei Einkaufsentscheidungen über andere Beschaffungsobjekte korruptionsstrafrechtlich erfasst, wenn der Entscheider Amtsträger oder Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen Betriebes ist. Auch Umsatzbeteiligungen an Arzneimittel- oder Medizinprodukteherstellern sind innerhalb geschäftlicher Beziehungen problematisch, denn die Abgrenzung erfolgt anhand der tatsächlichen Spürbarkeit des Einflusses der Beschaffung auf den individuellen Erlös. Erlaubt sind somit Kapitalbeteiligungen mit allgemeiner Gewinnausschüttung inklusive reiner Umsatzerwartung.
Einladungen, Bewirtungen, Werksbesichtigungen
Einladungen zu Freizeitveranstaltungen wie Fußballspielen sind außerhalb von aktuellen Wettbewerbssituationen oder gar Absatzverknüpfungen und Zuweisungsvereinbarungen grundsätzlich möglich, solange durch diesen Vorteil im Sinne der Sozialadäquanz keine besondere Motivation zu wettbewerblicher Bevorzugung geschaffen wird. Das sollte auch bei (Arbeits-)Essens-einladungen innerhalb einer 40- oder 50-Euro-Grenze pro Essen, zu kleinen Imbissen oder in Betriebskantinen möglich sein, wobei sachfremde Begleitpersonen oder Amtsträger sowie begleitende Angebote mit Vergnügungscharakter ausscheiden. Bei Folgeeinladungen ist präventiv auf Wechselseitigkeit zu achten, wogegen eine Stückelung durch mehrere Einladungen zu Umgehungszwecken unterbleiben muss.
Drittmittelforschung
Auf Basis der Grundsätze adäquaten Leistungsaustauschs, eindeutiger Leistungsbeschreibung und -dokumentation, transparenter Darstellung von Art, Umfang, Zeit, Beziehungen zu Mittelgebern und Kostenkalkulation sowie weitestmöglicher Unabhängigkeit von Beschaffungen sind u. a. die früher beliebten Aufwandsentschädigungen der Pharmaindustrie für klinische Studien oder Anwendungsbeobachtungen als Vorteil für bevorzugte Produktverordnungen verboten. Präventiv besonders wichtig ist deshalb die Bemessung von Aufwandsentschädigungen an qualifikations- und einsatzangemessenen Maßstäben, wobei gerade bei Forschungsprojekten mit Gesamtaufwänden verlässliche Summen schwer zu nennen sind. Immerhin dürften 150 Euro für einstündiges Ausfüllen eines umfangreichen Dokumentationsbogens mit Freitextbedarf nicht zu beanstanden sein, während umgekehrt der Betrag von 500 Euro für wenige Arbeitsminuten ein starkes Indiz für korrupte Verordnungs- oder Beschaffungspraktiken darstellt.
Fortbildungen, Produktschulungen
Die Übernahme ärztlicher Fortbildungs- oder Reisekosten, insbesondere durch Pharmaunternehmen, ist bei wissenschaftlichen Veranstaltungen oder allgemeiner Vertrauenswerbung generell zulässig. Allerdings beginnt das Korruptionsrisiko jenseits von Kostenübernahmen für Teilnahmegebühren, Reise- und Übernachtungskostenerstattungen sowie Bewirtungen als fachlichkeitsbegleitende Versorgung in angemessener, in Relation zum Gesamtveranstaltungswert untergeordneter Höhe. So sind z. B. ärztliche Übernachtungskosten in einem Vier-Sterne-Hotel und Teilnahmegebühren von 500 bis 1.000 Euro für zwei Kongresstage eines Arzneimittelherstellers zulässig. Bei einer „Luxus“-Unterbringung in Hotels mit fünf oder mehr Sternen, bei „Gourmet“-Verpflegung oberhalb einer 60-Euro-Grenze, bei fremdfinanzierten Unterhaltungs- oder Freizeitprogrammen, bei Kostenübernahmen für Begleitungen, bei sonstigen Rahmenvorteilen oder gar bei Absatzverknüpfungen beginnt somit der Korruptionsbereich.
Geld-/Sachspenden oder Bezuschussungen
Spenden sind nur bei wissenschaftlichem Forschungsnutzen oder Verbesserung der Gesundheits- oder Patientenversorgung oder zu Aus- und Weiterbildungszwecken oder aus Mildtätigkeit erlaubt, falls daneben hinreichende Unabhängigkeit vom Umsatzgeschäft und die Einzahlung von Geldspenden auf Einrichtungskonten inklusive ordnungsgemäßer Dokumentation gewährleistet sind. Unter diesen Voraussetzungen können beispielsweise Arzneimittelhersteller hohe Geldsummen mit und ohne überindividuelle, aber stets lautere Zweckbindung geben – also z. B. für gesamte Einrichtungen, spezielle Forschungsprojekte oder Abteilungsausstattungen, nicht jedoch als sogenannte Sozialspenden für Dienstjubiläen oder gezielt zur Verfügung einer Person.
Geschenke und Prämien
Geldzuwendungen, geldähnliche Zuwendungen oder Sachzuwendungen sind Hauptfälle aus dem Bereich der Geschenke und Prämien. Beinahe jeder Pflegekraft und vielen Ärzten dürften als nachträglicher Dank für Behandlungen solche Zuwendungen angeboten worden sein. Bis zu Werten von ca. 50 Euro an Behandlungsteams lassen sich Korruptionsvorwürfe mit Hinweis auf die Sozialadäquanz solcher Vorgänge entkräften. Dagegen sind Geschenke vor oder während Behandlungen, womöglich ausdrücklich zwecks Erlangung von Bevorzugungen, verboten. Auch hochwertige Werbegeschenke oder Prämien von Apotheken an Ärzte stehen generell unter Korruptionsverdacht, denn regelmäßig sind damit gezielte Verschreibungen hochpreisiger Arzneimittel inklusive einschlägiger Empfehlungen für Patienten intendiert. Identisch sind Unternehmensanteile, überhöhte Aufwandspauschalen und sonstige Prämien aller Art von Pharmaunternehmen an Ärzte gegen Bevorzugung bei Verordnungsentscheidungen zu beurteilen. Zu vermeiden ist auch eine langfristig angelegte Kumulation von Bagatellzuwendungen.
Kooperationen
Die vielfältigen und sehr unterschiedlich gestaltbaren Kooperationsmöglichkeiten sind nur bei sozial- und berufsrechtlicher Rechtmäßigkeit, nachvollziehbarem Interesse der Vertragsparteien, tatsächlichem Patientenmehrwert, Vergütungen innerhalb angemessen leistungsbezogener Korridore und ohne Ausschließlichkeitsregelungen im Sinne von Patientenwegebindungen zulässig.
Kostenübernahmen und Mitfinanzierungen
Gewährte Vergünstigungen durch Industrieunternehmen oder Leistungserbringer dürfen auch in Form von Kostenübernahmen und Mitfinanzierungen niemals mit Beschaffungsvorgängen oder Zuweisungen verknüpft werden. Umgekehrt sind auch kostenlose Überlassungen oder vergünstigte Vermietungen von Praxisräumen und Geräten sowie Darlehen durch Krankenhäuser für Niedergelassene gegen Zuweisungen korrupt.
Leih- und Geräteüberlassung sowie Materialzuwendungen
Industrieseitige Leih- oder Geräteüberlassungen sowie Materialzuwendungen bedürfen exakter Wertermittlung und Klarstellung des adäquaten Gegenleistungscharakters – typischerweise für Studiendurchführungen oder unter Beachtung von Spendengrundsätzen und werberechtlicher Beschränkungen. (Probe-) Geräte als Zugaben gegen unlautere Bevorzugungen im Beschaffungsmarkt sind beispielsweise korruptionsstrafrechtlich erfasst.
Autoren-, Berater-, Referentenverträge
Als Nebentätigkeiten sind vor allem Berater- und Referentenverträge gefragt. Die Qualifikation des Aufgabenübernehmenden, ein legitimes Interesse des Auftraggebers, eindeutige Leistungsbeschreibungen und -dokumentationen sowie erneut fehlende Absatzverknüpfung sind neben adäquatem Leistungsaustauschverhältnis die wichtigsten Rechtmäßigkeitsindizien. Zur Bestimmung der Adäquanz werden Art und Umfang der Tätigkeiten, Bedeutung und Komplexität der Themen, Grad der wissenschaftlich-fachlichen Qualifikationen, Verteilung der Ergebnisnutzungsrechte und Vergleiche mit der GOÄ oder Marktüblichkeit herangezogen. Deshalb sind z. B. Produktprüfungsverträge von Medizinprodukteherstellern mit ärztlichen Anwendern legal, wenn sich der Prüfumfang maximal auf die medizinisch ohnehin angezeigte und bereits eingesetzte Produktmenge beschränkt und sich das Honorar am üblichen Stundensatz orientiert. Auch Referate bei Tagungen oder Fortbildungsveranstaltungen gegen angemessene Honorare mit Stundensätzen von ca. 100 Euro für Assistenzärzte, ca. 150 bis 200 Euro für Fachärzte, ca. 200 bis 250 Euro für Oberärzte und ca. 300 Euro für Chefärzte und andere ausgewiesene Fachexperten, auch inklusive sachlicher Informationen über Wirkstoffe von Produkten eines Veranstalters, sollten keine Strafverfolgung auslösen. Anpreisungen von Veranstalterprodukten lassen dieses Ergebnis allerdings ebenso wie Vertragsgestaltungen mit nur unbestimmt-zukünftigen Beratungsleistungen auf Abruf gegen bereits feststehende Honoraransprüche umschlagen.
Rabatte, Musterabgaben, BoniBar-, Natural-, Mengen-, Funktions-, Treue-, Zeit- oder Saison-, Exklusivitätsrabatte, Geld oder Naturalvergünstigungen, Kostenerstattungen, Sachmittelzuwendungen, Boni, Umsatz- oder Gewinnbeteiligungen, Einkaufsgutscheine und Treuepunkte sind nur bei transparenter Darstellung durch die Vorteilsgeber sowie nachweislichem Patienten- oder Kassenvorteil wiederum ohne Verordnungs- oder Zuweisungsbindung legal. Produktrabatte für Ärzte als Gegenleistung für Bezugsbindungen bei weiteren Sachmittelanschaffungen verstoßen nach wie vor gegen Sozial-, Werbe- und ärztliches Berufsrecht und gelten inzwischen – wie auch Zuweisungsbindungen – innerhalb der Heilberufe sogar als Korruption.
Sponsoring
Sponsorengelder fließen für Tagungen, Kongresse, Weiterbildungen und Informationstermine für Laien- oder Fachpublikum, wobei generell Marketingmittel wie Plakate, Anzeigen, Ankündigungen, Stände und Werbebroschüren möglich sind. Voraussetzungen sind jedoch zum einen ein Vertrag zwischen Sponsor und Veranstalter mit Beschreibung eines ausgewogenen Leistungsaustauschs zwischen Werbemöglichkeit und Zuwendungshöhe einschließlich Verwendungszweckbestimmungen sowie Zahlungswegen an den Veranstalter selbst. Zum anderen sind aus Sponsorensicht inhaltliche Nähe zum Unternehmensgegenstand, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Transparenz durch Verwendungsnachweise des Begünstigten und Ausschluss privater, sachwidriger Präferenzen oder Sonderinteressen beachtlich. Natürlich darf die Zuwendung in keiner Weise mit Absatzbestrebungen des Sponsors verknüpft werden, weshalb beispielsweise kein Einfluss des Geldgebers auf konkrete Veranstaltungsinhalte erlaubt sein kann. Ebenso unzulässig sind wiederum Sponsoringvereinbarungen zur Förderung individueller Anlässe mit freizeitlichem Privatcharakter wie Jubiläumsfeiern oder Betriebsausflüge.
Verordnungen
Korruption liegt im Verordnungsbereich vor allem bei Kick-back-Zahlungen von Unternehmen an Produktverordnende mittels verschleiernd benannten Bonussystemen wie beispielsweise „Verordnungsmanagement“ oder „Bezugsprovision“ vor. Obendrein sind solche Zuwendungen oftmals getarnt als Spenden an Vereine von Chefärzten zur Ausstattung von Kliniken oder Unterabteilungen oder als Honorare für wertlose oder niemals durchgeführte Forschungen oder für Scheintagungen oder -referate. Allerdings sind Boni auf sozialrechtlicher Grundlage zur Förderung wirtschaftlichen Verordnungsverhaltens wegen des Gemeinnutzens erlaubt.
Weiterverweisung an Anschluss-Leistungserbringer
Bereits überhöhte Vermittlungsprovisionszahlungen von Krankenhäusern an Vergleichsinternetportale bergen trotz allgemeiner Marktzugangs- und Informationsmöglichkeit für Patienten und sonstige Interessierte Korruptionspotenzial nach § 299 StGB, weil eine sondervorteilsbedingte Bevorzugung im Empfehlungswettbewerb auf dem Weg zur Krankenhausbehandlung nicht auszuschließen ist. Auf dem Weg in die Weiter- oder Anschlussversorgung liefern gezielt individuelle Apothekenwerbungen in Wartebereichen von Arztpraxen oder Krankenhäusern oder Direktweiterleitungen von Verschreibungen von Ärzten an Apotheken Indizien für Korruption. Eindeutig korrupt sind Vergünstigungen von Anschlussdienstleistern an Ärzte für Verordnungen mit Empfehlungen. Auch überteuerte Anmietung von Krankenhaus-Räumlichkeiten durch Hilfsmittelerbringer gegen ärztliche Empfehlungsdienste sind hierunter zu verzeichnen. Weniger offensichtlich und dennoch korruptionsrechtlich verboten sind ärztliche Zuweisungen an Anschlussversorger oder Zuführungen von Untersuchungsmaterial an Labore mit Gewinnbeteiligung des Zuweisers oder eines Strohmannes am Folgegeschäft. Erlaubt sind wiederum Kapitalbeteiligungen mit allgemeiner Gewinnausschüttung wie auch räumliche Nähe von Krankenhäusern und Arztpraxen zu Apotheken, Heil- oder Hilfsmittelerbringern – bei allerdings wertangemessen auszugestaltenden Mietverhältnissen. Außerdem hielt der BGH in Zivilsachen 2011 und damit vor Geltung der §§ 299a f. StGB in zwei Urteilen auch zuweisungsprämienfreie ärztliche Empfehlungen, die auf eigenmotivierte Patientenanfragen erfolgten oder durch sachliche Gründe wie Wegevermeidung von Gehbehinderten, schlechte Erfahrungen mit anderen Leistungserbringern oder Versorgungsqualität begründet waren, für zulässig.
Kriminelle Katalysatorfunktion
Gruppenübergreifend ist zu ergänzen, dass illegale Zuwendungen in verkomplizierenden Zuwendungsdrei- oder -vielecken deutlich schwerer nachweisbar sind. Diese Verschleierungen sind in zahlreichen Konstellationen und in den meisten der vorgestellten Themengruppen praktikabel. Vereinfacht dargestellt sieht solch ein Tarnungsmodell folgendermaßen aus: Ein scheinbar wettbewerbsunabhängiger Vorteil fließt von einem Wettbewerber an einen Heilbe-rufsangehörigen, dafür bevorzugt Letzterer einen Mitbewerber des Vorteilsgebers. Erst bei einer ganz anderen Verordnungs-, Bezugs- oder Zuführungsentscheidung bevorzugt der Heilberufsangehörige dann den ursprünglichen Vorteilsgeber im Wege eines Rollentauschs gegen einen Vorteil des Erstbevorzugten. Erscheinen derartige Dreiecke noch auflös- und ausermittelbar, dürften jedenfalls professionell aufgezogene Konstrukte über zahlreiche Beteiligte auf Geber- und Nehmerseite in zeitlicher und räumlicher Streckung sowie vielfachem Wechsel der Bevorzugungs- und Vorteilscharakteristika Ermittlungsbehörden regelmäßig vor unüberwindliche Schwierigkeiten stellen.
Fazit und Prävention
Mangels hinreichender obergerichtlicher Rechtsprechung stehen all diese Einschätzungen natürlich unter Neudeutsch als „Rechtsmonitoring“ bezeichnetem Beobachtungsvorbehalt, wenngleich sich in der Korruptions-, Begehungs-, Ermittlungs- und Anklagepraxis schon eine Tendenz abzeichnet: Sowohl die Angehörigen der Gesundheitsberufe als auch die Verfolgungsseite scheinen sehr vorsichtig zu handeln und sich einerseits nicht durch besondere Vorteilsgier oder Leichtsinn auszuzeichnen, sich aber andererseits auch keine peinlichen Verfahrenseinstellungen oder Freisprüche leisten zu wollen. Perspektivisch ist interessant, ob es mittelfristig in größeren Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, angesichts der zunehmenden organisatorischen Verlagerung von wirtschaftlich besonders gewichtigen und damit korruptionsattraktiven Entscheidungen aus den klinischen Bereichen auf die Verwaltung (über zentrale Einkaufsabteilungen bis hin zu Vorständen und Geschäftsführungen), durch Entscheidungsträger außerhalb der Gesundheitsberufe zu einem Aufleben der altbekannten Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr nach § 299 StGB kommt. Grund zu Resignation und Fatalismus besteht trotz der noch nicht einmal abschließenden Fülle möglicher Korruptionskonstellationen, Abwandlungen und Tarnungsmöglichkeiten nicht. Allein die Beachtung der vier Hauptprinzipien der Korruptionsprävention vermeidet auch ohne Detailkenntnis den Löwenanteil aller Erscheinungsformen von Korruption im Gesundheitswesen durch extreme Verengung von Gestaltungsspielräumen:
- Das Äquivalenzprinzip fordert am Wirtschaftlichkeitsgrundsatz orientierte Gleichwertigkeit der Leistungen in Austauschverhältnissen. Hauptkriterien zur Bestimmung angemessener Vergütungen sind individuelle Kompetenzen der Leistungserbringer, Schwierigkeitsgrade, Zeitaufwände und Marktüblichkeit.
- Das Dokumentationsprinzip verlangt die lesbare, fortdauernde, eindeutige und auffindbare Niederlegung aller einseitigen und gegenseitigen Vereinbarungen und dient damit zugleich dem nächsten Prinzip.
- Die Einhaltung des Transparenz- und Genehmigungsprinzips als Offenlegung von Vereinbarungen mit Zuwendungscharakter gegenüber Krankenhausverwaltung und Krankenhausleitung durch Anzeige oder Zustimmungseinholung wird nämlich durch Vorgangsdokumentation perfekt unterstützt. Hinzu kommt die transparenzstärkende Bargeldlosigkeit als Unterprinzip.
- Das Trennungsprinzip postuliert inhaltliche Unabhängigkeit von Zuwendungen und gesundheitswettbewerblichen Entscheidungen, insbesondere bei Beschaffung, Verordnung und Therapie.
- Zwecks Kostendistanz erfolgen Abgrenzungen und Zugriffsausschlüsse von Beschaffungsentscheidern und Zuwendungsbegünstigten.